Social-Media-Verbot für Kids? Der schwere Weg ist der bessere.
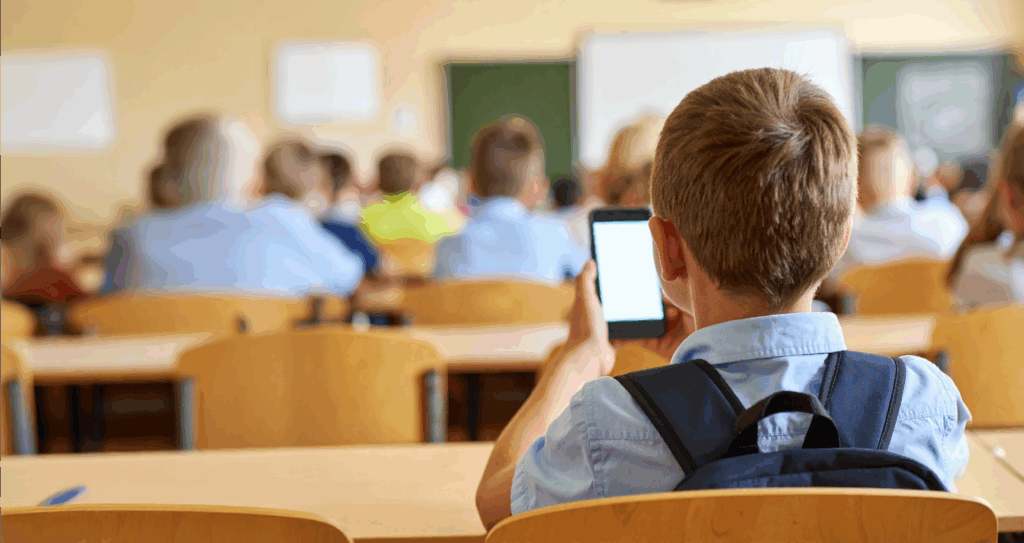
Einige Länder haben es vorgemacht und wie so oft bei Ideen für mehr Einschränkungen (warum eigentlich nie bei denen für harte Steuerreduzierungen oder Entlastungen?) gibt es auch diesmal Politiker links und rechts der liberalen Mitte, die das gutheißen und nachahmen wollen. Die Rede ist von einem Verbot von Social-Media-Plattformen für Kids.
Klar, es gibt immer gute Argumente dafür. Selten sind Einschränkungen der Freiheit von vornherein mit böser Absicht eingeführt worden. Gerade, wenn es um Kinder geht, wollen ja alle Politiker nur das Beste.
Als vielleicht noch weichestes Argument wird der Schutz vor Ablenkung in die Diskussion geworfen. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich das lese. Ja, auch für mich als jemand, der die 14 schon vor ein paar Jahren hinter sich gelassen hat, sind soziale Medien eine starke Ablenkung. Manchmal willkommen, manchmal sehr nervig. Oft staune ich, wie viel Zeit man da veratmen kann.
In meiner Jugend gab es noch keine sozialen Medien. Das Internet entwickelte langsam zarte Blüten und ächzte mit 28 KBit/s durch die Leitung. Wenn man Glück hatte, mit 56 KBit/s. Ein Bild brauchte teilweise mehrere Minuten, bevor es aufgebaut war. Instagram swipen wäre da eine abendfüllende Veranstaltung gewesen.
Wer aber denkt, man hat sich nicht abgelenkt, naja, der hat die Schulzeit der 90er heute weitgehend ausgeblendet. Analoges TV, Bücher oder einfach Zettel und Stift konnten auch ganz gut dafür sorgen, dass Schulaufgaben und selbst der Unterricht nicht immer die volle Aufmerksamkeit bekamen. Ein Glück, dass man Fernseher damals nicht mitnehmen konnte, sonst wäre niemand mehr dem Unterricht gefolgt.
Wäre nicht die bessere Lösung, den Unterricht erst einmal spannender zu machen? Der Lernstoff ist meist ja nicht das Einschläfernde, sondern wie er verpackt und präsentiert wird. Auch wenn Unterricht nicht gleich in Unterhaltung ausarten muss, stellt sich schon die Frage, warum bei dem herausragenden Stand der Pädagogik viele Schulen und ihre Lehrer oftmals noch die Lernmethoden anwenden, die schon von vor 30 Jahren als veraltet galten. Vielleicht kann man erst einmal da ansetzen.
Schulen heute wissen zudem um den Trend zur Handyablenkung und reagieren auch darauf. Die meisten Schulen haben Regeln im Umgang mit Smartphones. Doch der Unterschied zu einem Gesetz ist, dass Schüler, Eltern und die Lehrer an der Entwicklung dieser Ordnungen für gewöhnlich beteiligt sind. Eigenverantwortung und ehrenamtliches Engagement sorgen für eine gemeinsame Vereinbarung, die idealerweise praxistauglich und zielgenau ist.
Ich habe als Elternsprecher selbst vor ein paar Jahren so eine Entwicklung begleitet. Ich fand es beeindruckend, wie intensiv alle Partner gemeinsam an dieser Ordnung gearbeitet hatten. Nicht jede Idee wurde berücksichtigt und mir selbst war sie noch zu restriktiv. Aber so ist es nun einmal, wenn es nicht vorgegeben, sondern als Kompromiss in Eigenverantwortung ausgearbeitet wird. Das ist etwas, was sich eine selbstbewusste Gesellschaft nicht wegnehmen lassen sollte.
Der nächste, oft gehörte Einwand pro Verbot ist der Schutz vor Cybermobbing. Cybermobbing ist eine ernste Sache, die Schülern das Schulleben und die Freude am Unterricht durchaus verderben können. Im schlimmsten Fall drohen Konsequenzen für Leib und Leben. Jeder, der die Schulzeit erlebt hat, kennt Beispiele, hat es selbst erlebt oder gesehen, wie andere darunter litten.
Das ist auch kein Thema, mit dem man spielen darf. Und schon gar nicht darf es als Argument für ein untaugliches Gesetz gelten. Denn das Problem von Cybermobbing ist nicht die Plattform, auf der es stattfindet. Das Problem lässt sich auch nicht mit dem Verbot der Plattform verbieten. Konsequent gedacht ist die tatsächliche Plattform von schulischem Cybermobbing ja eigentlich die Schule. Die Idee, Schulen zu verbieten, ist glücklicherweise noch nicht mehrheitsfähig.
Richtig ist dagegen, hart gegen die Verursacher vorzugehen. Lehrer, die wegschauen, wären ein Problem. Keine Konsequenzen wären ein Problem. Täter-Opfer-Umkehr wären ein Problem. Statt wegen Räuber den ganzen Wald niederzubrennen, müssen Opfer geschützt und gestärkt werden und den Täter klar und deutlich Strafe, scharfe gemeinschaftliche Ablehnung und in letzter Konsequenz Ausschluss drohen.
Das ist ganz sicher nicht der einfache Weg. Und er verlangt der Gesellschaft mehr ab. Denn es bedeutet, mehr als bisher für Mitmenschen da zu sein, auch wenn sie nicht im Mittelpunkt der Gemeinschaft stehen. Es bedeutet, selbst einzuschreiten, wenn Unrecht geschieht und die Kinder auch dazu zu ermuntern.
Aber wollen wir unsere Kinder nicht genau dazu erziehen? Wollen wir nicht selbstbewusste Bürger als Töchter und Söhne haben, die nicht leise sind, wenn ein anderer gemobbt sind? Die gute Nachricht ist, dass es schon sehr viel öfter in den Klassenverbänden passiert, als wir mitbekommen. Wir sehen ja oft nur die negativen Fälle. Soziales Verhalten ist Teil der Entwicklung zum Erwachsenen, das sich selten über Gesetze, dafür umso nachhaltiger über die Gemeinschaft prägt. Und unser Nachwuchs ist dazu durchaus in der Lage, es positiv zu prägen.
Ein weiteres Argument für ein Verbot ist der Schutz vor unangemessenen Inhalten. Natürlich will jede Mutter, jeder Vater das eigene Kind vor diesen Themen im Netz oder auch sonstwo schützen. Auch wenn sich schon bei der Frage, was dazu zählt, die Geister scheiden. Aber würde das wirklich durch den Verbot von sozialen Medien aufhalten lassen?
Wie beim Cybermobbing stellt sich die Frage, ob es für diesen Schutz der richtige Weg ist, den Zugang zu sozialen Medien radikal zu beschneiden. Pornographie und andere fragwürdige Inhalte sind ein relativ geringer Teil des Austauschs über soziale Medien.
Der überwiegende Teil des Austauschs geht um banale Themen, Spaß, Trends und vieles mehr. Bei jungen Menschen dürfte die Relation noch kleiner sein. Für dieses Problem die Plattformen zu beschneiden, wäre in etwa so, als würde man Fahrräder verbieten, weil es Diebe gibt, die auf der Straße Handy und Handtaschen klauen und damit schnell flüchten. Könnte wirken, trifft aber ganz sicher überwiegend Unschuldige.
Zudem machen die Plattformen in dem Bereich schon relativ viel. Ob durch Vorgaben gezwungen oder auf Eigeninitiative, vermag ich nicht einzuschätzen. Aber es wird immer genauer drauf geschaut, was an Inhalten auf den Plattformen zu finden ist und immer öfter wird eingeschritten. Natürlich gibt es immer noch Schmuddelecken, das will ich nicht bestreiten. Wie halt im richtigen Leben. Aber eine positive Tendenz ist erkennbar.
Zuletzt müssen wir uns im Klaren sein, wie erfindungsreich und flexibel Menschen sind. Vor allem die jungen unter uns. Greift ein Verbot und Social-Media-Plattformen werden verboten, ist damit doch nicht Schluss mit den digitalen Kontakten.
Schneller als irgendein Politiker werden neue Formen zum Trend, die durch das Gesetz nicht abgedeckt sind. Schon heute bieten die meisten Messenger viele Funktionen der ehemals erfolgreichen Plattformen wie Facebook & Co und darüber hinaus an. Selbst für die Eltern, die direkt dran sind und die mit den Anfängen groß geworden sind, ist es schwer, da hinterher zu kommen. Denn der Markt wird immer größer und vielfältiger. Das ist gut so, macht aber eine gesetzliche Eingrenzung unglaublich schwer.
Die Konsequenz wäre, den jungen Menschen ganz das Netz zu verbieten. Aber geht das überhaupt noch? Jede Schule hat heutzutage eine App, nebenbei oft auch mit einer Chat und Austauschfunktion. Ein Großteil des Unterhaltungsangebots läuft heute digital. Netflix, Disney und die vielen anderen süßen Entertainer wären dann für die Kinder tabu.
Das kann man machen. Es gibt viele Eltern, die genau das für ihre Kinder durchsetzen. Oder zumindest stark beschränken. Aber – und das ist der Punkt – das ist die Entscheidung der Eltern. Ein staatliches, gesetzlich verankertes Verbot greift dagegen tief in die Verantwortung und in den Entscheidungsbereich der Familie und damit in die private Sphäre der Menschen ein.
Solange nicht Straftaten begangen oder Kinder vernachlässigt werden, geht es den Staat nichts an, wie Kinder erzogen werden, welche Konzepte Eltern haben und was ihnen im Alltag der Familie wichtig ist. Es ist alleinige Aufgabe der Erziehungsberechtigten, diese Entscheidungen zu treffen, manchmal schmerzhaft, manchmal auch nachgiebig. Das ist völlig in Ordnung. Denn das ist neben der Pflicht auch ihr Recht.
Dieser liberale Grundsatz verliert immer mehr an Bedeutung in einer Gesellschaft, in der die Politik dazu neigt, jeden Lebensbereich komplett abzusichern. Je mehr die Parteien sich auf die Ränder zubewegen, desto weniger spüren sie noch diese eigentlich einmal selbstverständlichen Grenzen.
Und die Bürger? Für viele ist es halt einfacher, wenn Entscheidungen abgenommen werden. Ist es auch besser? Nein, ganz bestimmt nicht. Denn die Entscheidungsabnahme führt zu einer schleichenden Unfreiheit, weniger Selbstständigkeit und weniger bewusstes Handeln. Und für alles müssen die Bürger dann auch noch über ihre Steuern bezahlen. Denn zu jeder Regel müssen zwangsläufig auch Verfahren und Personalstellen aufgebaut werden, die diese Vorschriften dann kontrollieren und sanktionieren.
Letztlich wird so ein Verbot, wenn es dann kommt, ein teurer Papiertiger werden, mit dem wieder ein Stück Freiheit flöten geht, ein Stück mehr Bürokratie entsteht und die Politik der digitalen Entwicklung ein Stück hinterherhinken wird. Brauchen wir das? Ich sage Nein. Entscheidungsgewalt in den Händen selbstbewusster Bürger mit geradem Rücken ist der bessere, wenn auch schwerere Weg.